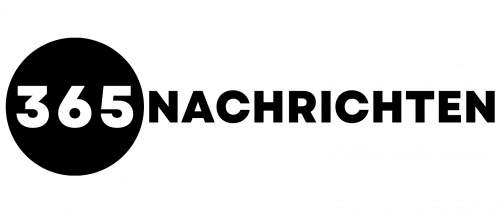Akkus sollen in Zukunft kein Lithium mehr enthalten, das wird immer knapper. Künstliche Intelligenz sucht blitzschnell nach Materialien für den Ersatz
Mithilfe von KI wollen sich Materialforscher rascher im Dschungel potenzieller Werkstoffe orientieren. Besonders flink gelang neulich die Suche nach einer Alternative für Lithium in Batterien. Doch die Sache hat einen Haken.
In einem Solebecken in der chilenischen Atacama-Wüste wird Lithium verarbeitet – hier ein Blick aus der Vogelperspektive im Jahr 2023.
Rodrigo Abd / AP
Es ist der Traum von Batterieforschern: Nach kurzer Suche auf ein brandneues Material zu stoßen, das E-Auto-Batterien gleichzeitig billig, kompakt und umweltfreundlich macht – und trotzdem pro Ladung tausend Kilometer schafft.
Eine solche Suche, bei der eine Alternative zum derzeit verwendeten Lithium angestrebt wird, ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Denn Batteriehersteller wollen von dem Rohstoff unabhängiger werden. Das Element droht knapp zu werden, je mehr sich E-Autos und Heimspeicher für Solarenergie durchsetzen, die Lithiumakkus benötigen.
Zudem steht der Abbau von Lithium in der Kritik, weil er etwa in Chile den Grundwasserspiegel senkt oder im Tagebau Landschaften zerstört.
Eine der größten Quellen für Lithium ist die Mine der chilenischen Sociedad Química y Minera in der Atacama-Salzebene (Aufnahme vom 10. Januar 2013).
Ivan Alvarado / Reuters
In der Lithium-Pilotanlage von Rincon Mining, gelegen in der argentinischen Salzwüste Salar del Rincón, greift ein Mitarbeiter in einem Behälter mit Lithiumkarbonat.
Agustin Marcarian / Reuters
Gefragt sind auch neue, leichter verfügbare und umweltschonende Materialien – zum Beispiel Natrium. Doch das eröffnet ein weites Feld: Denn chemische Elemente lassen sich in Millionen Varianten zu neuen Batteriematerialien kombinieren, vergleichbar mit einem Lego-Baukasten mit vielen verschiedenen Teilen. Eine Variante zu finden, die alle Wunscheigenschaften vereint, gleicht der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, die viele Jahre dauert.
Künstliche Intelligenz verkürzt die Suche auf eine Woche
Dass es mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) sehr viel schneller als mit herkömmlichen Methoden geht, zeigen nun Forscher von Microsoft und dem Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) im amerikanischen Gliedstaat Washington. Das Team um Chi Chen von Microsoft fand einen Ersatz für eine lithiumhaltige Batteriekomponente, die mit 70 Prozent weniger Metall auskommt.
„Wir haben zwanzig Jahre Suche auf eine Woche verdichtet“, sagt Nathan Baker von Microsoft. Das Team beschreibt das Verfahren auf dem Preprint-Server Arxiv. Die Arbeit wurde noch nicht von Fachkollegen begutachtet.
Forscher nutzen schon seit Jahrzehnten den Computer, um nach neuen Werkstoffen zu fahnden. Sie simulieren neue Substanzen, um deren Eigenschaften vorherzusagen. Im Labor werden dann nur noch Materialien tatsächlich synthetisiert, die in der Simulation die gewünschten Eigenschaften gezeigt haben.
Doch das übliche Suchverfahren benötigt viel Rechenzeit, weil es hochkomplexe Gleichungen der Quantenphysik lösen muss. KI arbeitet ganz anders. Sie kennt die physikalischen Regeln nicht, sondern erwirbt etwas, das menschlichem Erfahrungswissen ähnelt.
Die KI lernt Zusammenhänge aus der Materialkunde
In einer Lernphase erhält die KI Daten von Tausenden Materialien, die sowohl deren Aufbau aus chemischen Elementen beschreiben als auch ihre Eigenschaften, also ob das Material stabil ist oder wie gut es elektrisch geladene Atome (Ionen) leitet. Daraus lernt die KI statistische Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften der Materialien.
Das Erstaunliche dabei: Die KI lernt Zusammenhänge, die für die ganze Materialklasse gelten, also nicht nur für die Werkstoffe im Trainingsdatensatz. Mit dem erlernten Modell kann sie schnell abschätzen, ob ein neuer Kandidat die gewünschten Eigenschaften besitzt.
Manche Batterieanoden bestehen aus Kupferfolien, die mit thermisch verdampftem Lithiummetall beschichtet sind – hier fotografiert am 22. März 2023 im CSEM Battery Innovation Hub in Neuenburg.
Christian Beutler / Keystone
Das Team um Chi Chen suchte nach einem Werkstoff für einen festen Elektrolyten. Diese Komponente der Batterie transportiert Ionen zwischen den Polen der Batterie. Um Akkus feuerfest zu machen, wollen Hersteller Elektrolyten durch Festkörper ersetzen. Das würde kompaktere Batterien ermöglichen, etwa für kleine Elektroflugzeuge. Auch dieser Festkörper sollte möglichst wenig Lithium enthalten.
Innerhalb von 80 Stunden wählte die KI der amerikanischen Forscher aus 32 Millionen Kandidaten achtzehn aus. Das geschah mithilfe mehrerer KI-Modelle, die nacheinander jeweils nach einer gewünschten Eigenschaft gefiltert wurden. Das erste prüfte, ob ein Material stabil ist. Etwa eine halbe Million der Kandidaten bestanden. Die anderen Modelle filtern Stoffe nach elektronischen Eigenschaften. So schieden zum Beispiel elektrisch isolierende Materialien aus. Eine hohe Leitfähigkeit für Ionen ist dagegen besonders wichtig.
Im Labor werden die Kandidaten untersucht
Computer können nicht garantieren, dass die Materialien tatsächlich so funktionieren wie vorhergesagt. Auch KI kann das nicht. Deshalb müssen die verbliebenen Kandidaten im Labor synthetisiert und untersucht werden. Vier davon haben die Forscher des PNNL bereits geprüft. Einer gefiel ihnen besonders. „Der Elektrolyt enthält 70 Prozent weniger Lithium als in anderen Ankündigungen der Industrie“, erklärt Nathan Baker. Ein Großteil der Lithiumatome in seinem Kristallgitter ist durch Natriumatome ersetzt.
Natrium gilt in der Batterieforschung als billigerer und leicht verfügbarer Ersatz für Lithium, da es ähnliche chemische Eigenschaften hat. Es gibt tausendmal mehr Natrium in der Erdkruste als Lithium, auch in Europa lagern große Reserven. Das Element wird aus Speisesalz gewonnen, dessen Abbau in Salzbergwerken oder aus dem Meerwasser etabliert ist.
Der neu gefundene Festkörper-Elektrolyt passt gut zu diesen Bestrebungen. Nicht nur, weil er selbst weniger Lithium enthält, war ein wichtiger Zwischenschritt zum vollständigen Verzicht auf das Element. Sondern auch, weil er sowohl Lithium- als auch Natrium-Ionen sehr gut leitet. Somit könnte er sich für Batterien eignen, deren Pluspole eines der beiden Elemente oder auch eine Mischung davon enthalten. Er bietet auch Freiheit für verschiedene Batteriedesigns. Das Team um Chi Chen hat Batterie-Prototypen damit gebaut, die es derzeit getestet hat.
Auch Materialien für Solarzellen kann man KI suchen lassen
Die Materialforscher des PNNL sind nicht die ersten, die KI als Entdeckungswerkzeug nutzen. Seit etwa zehn Jahren entwickeln Materialwissenschaftler ähnliche KI-Modelle. Pascal Friederich sucht damit nach neuen Materialien, etwa für Solarzellen, die gleichzeitig hocheffizient und langlebig sind – was mit heutigen Werkstoffen noch nicht gelingt.
„Mit KI können wir innerhalb weniger Stunden die Eigenschaften von 100 000 potenziellen Materialien vorhersagen“, erklärt der Experte für computergestützte Materialentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie. «Die klassischen Simulationsmethoden brauchen dafür mehrere Wochen.» Die KI-gestützte Methode ist außerdem mehr als 100 Mal schneller. Solche Vergleiche seien allerdings schwierig, da sie stark von der eingesetzten Rechenleistung abhingen, betont Friederich.
KI nutzt meist Grafikprozessoren (GPU), während die klassische Methode normale Prozessoren verwendet. Da KI derzeit boomt, sind GPU sehr teuer, und nicht jede Institution kann sie sich leisten. Für Microsoft ist das die Chance, die Materialsuche per KI als Service in seiner Cloud anzubieten.
Nathan Baker von Microsoft spricht sogar von einer „neuen Kunst, Chemie zu betreiben“. Werden Chemiker auch bald durch KI ersetzt? Pascal Friederich widerspricht: „Ich sehe KI als ein zusätzliches Werkzeug neben Experimenten und klassischen physikalischen Simulationen.“ Nur so könne sie die Forschung beschleunigen, betont der Physiker.
Manche vermeintlichen Erfolge sind gar keine
KI allein liefert kein neues Wissen. Die Zusammenhänge zwischen der Struktur eines Materials und seinen Eigenschaften, die sie lernt, sind statistisch, es sind Korrelationen. „Wir Forscher und Forscherinnen müssen mit unseren klassischen Methoden kontrollieren, dass die Korrelationen tatsächlich physikalischen Zusammenhängen entsprechen“, sagt Friederich. Es kommt etwa vor, dass sich ein als stabil vorhergesagtes Material im Labor nicht synthetisieren lässt.
Damit die KI weniger Fehler macht, welche im Labor unnötige Zeit kosten, müssen sie aus ihren Fehlern lernen können. Der Test im Labor liefert neue Daten, mit denen die KI nachtrainiert werden soll, um treffsicherer zu werden. „Dieses Feedback wird derzeit intensiv erforscht“, sagt Friederich.
Doch auch wenn das gelingt, wird die KI weitere Fehlprognosen machen. Die Chemie von Festkörpern ist komplex. Bei der Synthese im Labor können je nach Druck oder Lösemittel andere Substanzen entstehen – nicht jede Variante wird die Wunscheigenschaften haben. Um die wenigen «Goldnuggets» herauszufiltern, wird auch in Zukunft viel Laborarbeit nötig sein. Forscher arbeiten aber schon an der Automatisierung von Laborexperimenten mithilfe von Robotern und KI.
Gewiss zieht KI in den Alltag von Materialwissenschaften ein. Ob sie tatsächliche Materialien für eine Rundum-Sorglos-Elektroautobatterie findet, bleibt aber abzuwarten.
Bis man auf den Abbau von Lithium wie hier in der Atacama-Salzebene verzichten kann, dürfte es selbst mit KI-Hilfe noch einige Zeit dauern.
Ivan Alvarado / Reuters